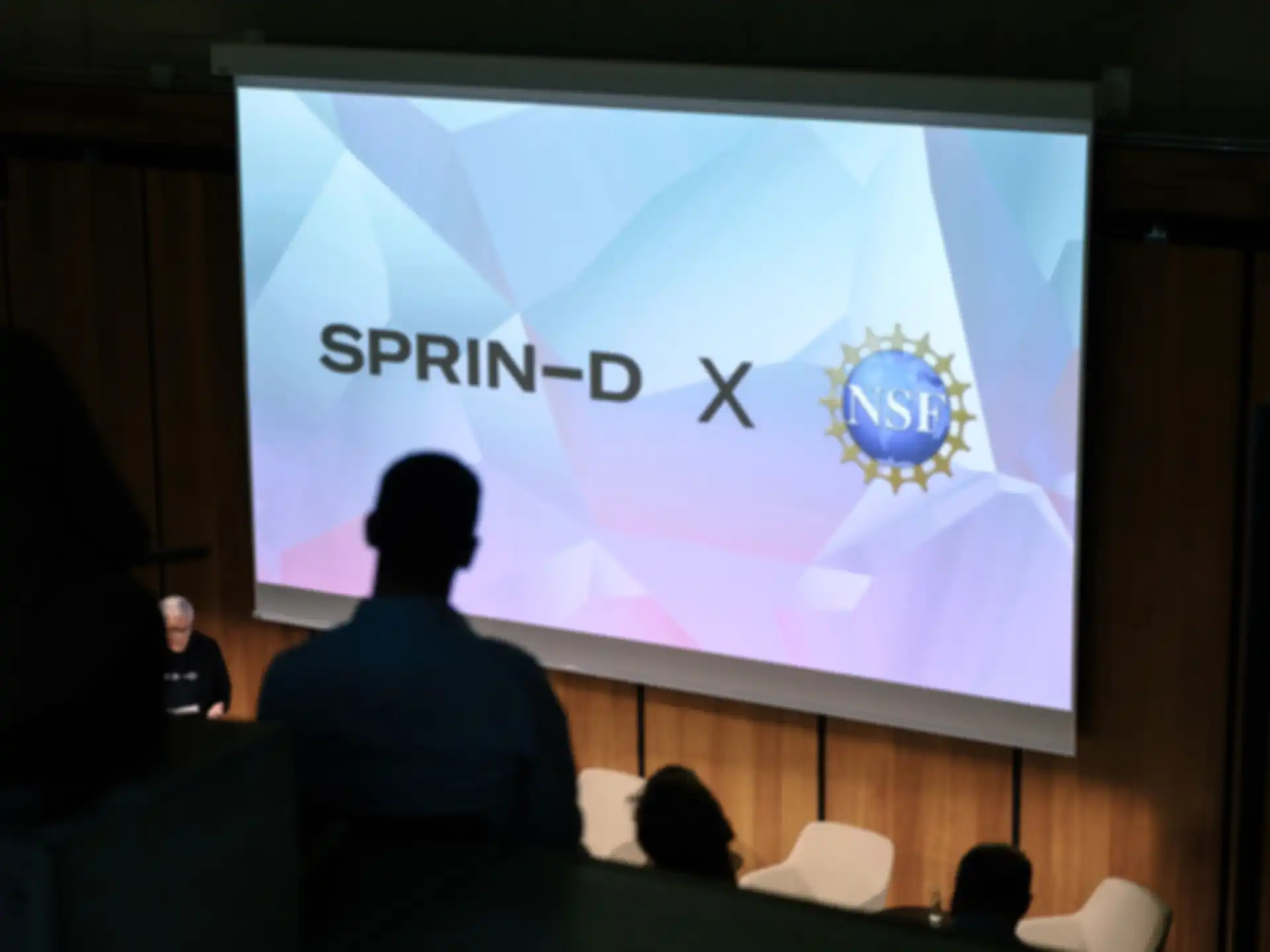4.11.2025
WIR KÖNNEN NOCH WELTMEISTER
Ein Beitrag von Rafael Laguna de la Vera und Thomas Ramge
Innovationsprozesse beginnen in der Regel mit einer Analyse des Status quo. Wie innovativ ist Deutschland heute? In den meisten internationalen Innovationsrankings schneiden wir nach wie vor gut ab, schaffen es aber nicht mehr aufs Treppchen. Meist landet Deutschland irgendwo zwischen Platz fünf und zehn. Die Lage der Innovationsnation ist nicht so schlecht, wie der Chor der Pessimist:innen oft tönt. Aber ebenfalls offenkundig ist: Wenn wir an unsere historischen Innovationserfolge von der Gründerzeit und den 1950er und 1960er Jahren wieder anknüpfen wollen, müssen wir dem deutschen Innovationssystem auf die Sprünge helfen.
Wie könnte eine zweite Gründerzeit aussehen, die herausragende Forschung in Erfindungen und dann neue Industrien überführt – so wie es Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts beispielsweise Robert Bosch, Gottlieb Daimler, Friedrich Bayer, Werner von Siemens und Alfred Krupp gelungen ist? Und wo bietet die deutsche Erfolgsgeschichte unter der wirtschaftspolitischen Führung Ludwig Erhards historische Lehren, wie sich Deutschland mit neuen Weltmarktführern und starken Konzernen als Innovationsnation mit Weltmeisterambition selbst neu erfinden kann?
Mindestens drei Sprünge müssen hierfür gelingen:

Das Wissenschaftssystem der Gründerzeit nach 1871 war nicht nur finanziell gut ausgestattet, unter anderem durch Reparationsgelder aus dem Deutsch-Französischen Krieg. Es war auch an den Schnittstellen von Wissenschaft und Industrie überraschend durchlässig. Professoren führten ihre Lehrstühle so wirtschaftsnah, wie wir es heute eher von amerikanischen Eliteunis kennen, die sich das deutsche System wiederum damals genau angeschaut hatten. Doktorand:innen wechselten flexibel aus Instituten in frisch gegründete Unternehmen und bei Bedarf wieder zurück. Bayer, Daimler, Siemens und BASF wurden mit exklusivem geistigen Eigentum gegründet. Heute fielen sie in die Kategorie IP heavy Start-ups
. Und sie bekamen vom Staat großzügige Anschubfinanzierungen. Der Return on Investment
des späten Kaiserreichs war ein Wirtschaftsboom, der Deutschland nicht nur seinen Platz als wirtschaftliche Großmacht sicherte, sondern auch den Aufbau eines vorbildlichen Sozialstaats finanzierte.
Nicht jede:r herausragende Wissenschaftler:in muss ein DeepTech-Start-up gründen. Aber wir müssen jene viel stärker fördern, die Lust darauf haben. Wenn Forschende auf Grundlage ihrer Forschungsergebnisse mit einem Businessplan für ein Spin-off bei der Lizenzabteilung ihrer Forschungseinrichtung aufschlagen, stehen ihnen meist langwierige Verhandlungen bevor. Ergebnis dieser Verhandlungen sind dann oft restriktive Bedingungen und hohe Beteiligungen der Mutterhäuser
, die für den Rest der Unternehmensgeschichte ein Klotz am Bein bleiben. In den USA sind stille Beteiligungen der Investmentvehikel der Universitäten in Höhe von drei Prozent üblich. Das gibt den Gründer:innen den Freiraum, mit privatem Risikokapital international Champion zu formen. Die gute Nachricht lautet: Mit der Transferallianz kommt auch in Deutschland endlich Bewegung ins Lizenzspiel.
Geistiges Eigentum ist freilich nur ein Aspekt des ganz formalen Wahnsinns
mit dem Gründer:innen im Allgemeinen und Sciencepreneur:innen im Besonderen zu kämpfen haben. Meist findet sich mit viel Zeit und Mühe irgendwann eine Lösung. Aber rechtliche und bürokratische Hürden – von überzogenem Datenschutz über Dokumentationspflichten bis zum Arbeitsrecht – sind einer der beiden größten Wettbewerbsnachteile deutscher Innovator:innen. Wir brauchen Fast-Track-Verfahren für Technologie-Gründungen und One-Stop-Shops für alle rechtlichen Fragen. Der zweite große Wettbewerbsnachteil für die hochinnovativen Weltmeister der Zukunft ist Zugang zu Kapital.
Deutsche Start-ups sterben nicht in der Gründungsphase, zumindest nicht aus Kapitalmangel. In der Regel scheitern sie, wenn die Technologie bewiesen hat, dass sie funktioniert und dann globale Märkte erobern soll. Während amerikanische und chinesische Konkurrenten in späteren Finanzierungsrunden für die Wachstumsphasen hunderte Millionen einsammeln, müssen deutsche Unternehmen mit Bruchteilen auskommen – oder abwandern.
Ein Teil der Lösung ist ein integrierter europäischer Kapitalmarkt. Dazu gehört auch eine europäische Tech-Börse, die es Wachstumsunternehmen ermöglicht, kapitalmarktfähig zu werden, ohne nach New York oder London zu müssen. Gleichzeitig müssen wir unsere Pensionsfonds und Versicherungen mobilisieren. Während amerikanische Rentenfonds selbstverständlich in Venture Capital investieren, verstecken sich deutsche Institutionen hinter regulatorischen Ausreden. Das ist nicht nur renditefeindlich, es ist innovationsfeindlich. Gleiches gilt übrigens auch für die Zurückhaltung großer europäischer Unternehmen, aufstrebende Start-ups-Davids zu übernehmen und ihre Technologien und Produkte dann mit den Vertriebsmöglichkeiten eines global vernetzten Goliaths zum Welterfolg zu verhelfen.
Ein neuer Pakt zwischen Staat und privatem Kapital kann hier einen wichtigen Beitrag leisten: Der Staat stellt Teilgarantien für Spätphasen-Investitionen, private Investoren bringen Know-how und Netzwerke ein. So bekommen auch deutsche DeepTech-Unternehmen Zugriff auf die tiefen Taschen, die nötig sind, aus einem wissenschaftlichen Durchbruch ein global erfolgreiches Unternehmen zu machen – so wie Özlem Türeci und Uğur Şahin aus den Erkenntnissen der mRNA-Forschung den globalen Player BionTech geformt haben.
Die Alternative ist ebenfalls offenkundig: Unsere besten Köpfe entwickeln in München oder Heidelberg, Hamburg oder Berlin spannende Technologie – und verkaufen sie dann an chinesische oder amerikanische Konzerne oder Investmentfonds. Heute gehen rund 80 Prozent der vom High-Tech Gründerfonds (HTGF) co-finanzierten Unternehmen beim Exit in ausländische Hände. Damit wandert dann auch der Großteil der Wertschöpfung aus Deutschland ab.
In vielen Gesprächen mit Politiker:innen und Vertreter:innen großer deutscher Unternehmen nehmen wir eine grundpessimistische Haltung wahr. Der weitere Abstieg Deutschlands und Europas sei im Rennen gegen die Tech-Supermächte USA und China vorherbestimmt. Den Status quo zu halten, wäre schon ein Erfolg. Dieser Pessimismus ist nicht nur die beste Anleitung, den Abstieg zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden zu lassen. Er ist mit einem nüchternen Blick auf Ressourcen und Potentiale offenkundig Unsinn. Der Lauf der Dinge ist nicht vorherbestimmt, sondern Ergebnis von Entscheidungen und Handlungen.
Die notwendigen Schritte in eine gelungene wirtschaftliche Zukunft Deutschlands dank hoher Innovationskraft sind bekannt. Der Draghi-Report vom Herbst 2024 hat sie für Europa sehr systematisch aufgearbeitet. Auf eine Formel gebracht lauten sie: Regulierung runter, Investitionen rauf, potentielle Sprunginnovator:innen fördern und dann machen lassen. Gesellschaftlich ist die Grundvoraussetzung für den Sprung an die innovative Weltspitze ist jedoch eine Rückkehr zum Technikoptimismus des späten Kaiserreichs und der jungen Bundesrepublik.
Die heutige Überregulierung in Deutschland und Europa ist Ausdruck von Angst und Misstrauen, Angst vor der Zukunft und Misstrauen gegenüber Individuen in Verantwortung. Wenn wir als Land und Kontinent Angst und Misstrauen als Default-Einstellung überwinden, werden wieder viele neue Weltmarktführer in neuen Industrien aus Deutschland kommen. Wir haben die Wissenschaftler:innen, die Ingenieur:innen und wir haben das Kapital. Ob wir im großen Innovationsspiel wieder ganz vorne mitmischen wollen, ist keine Frage des Wissens, Könnens oder der Ressourcen, sondern der Ambition.
Über die Autoren:
Rafael Laguna de la Vera ist Gründungsdirektor der Bundesagentur für Sprunginnovationen.
Dr. Thomas Ramge ist Sachbuchautor, Keynote-Speaker und Host des Podcast SPRIND
.